Methoden zur Bewertung der Wirksamkeit orthopädischer Maßeinlagen – eine systematische Literaturanalyse
Zusammenfassung:
Hintergrund: Aufgrund mangelnder Evidenz für die Wirksamkeit orthopädischer Einlagen, wird zur Sicherung deren Kostenübernahme durch die Krankenkassen in Zukunft die Durchführung metho-disch verbesserter klinischer Studien notwendig werden.
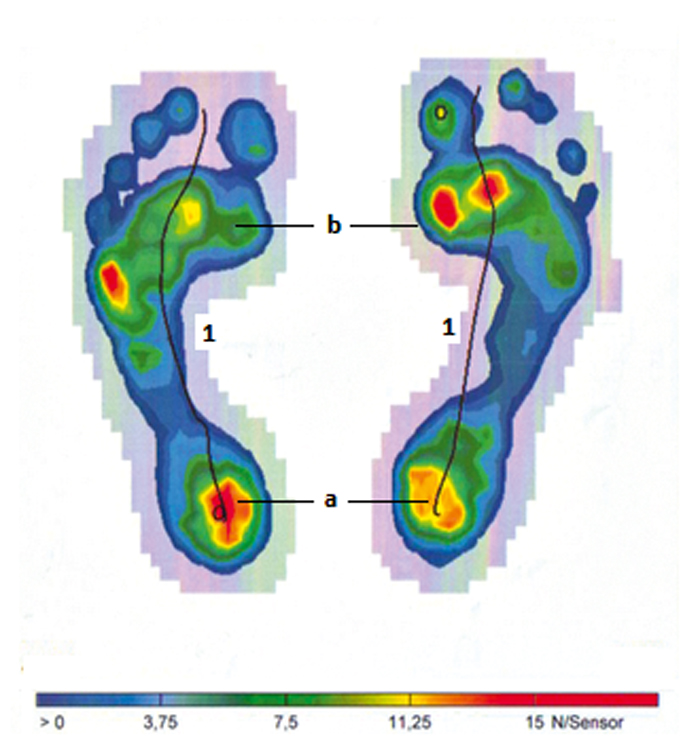
Dieser Review befasst sich mit der Bewertung methodischer Ansätze zur Prüfung der Wirksamkeit orthopädischer Einlagen. Ziel ist die Identifikation geeigneter Untersuchungstechniken für die Generierung einer Evidenz mittels standardisierter Protokolle.



