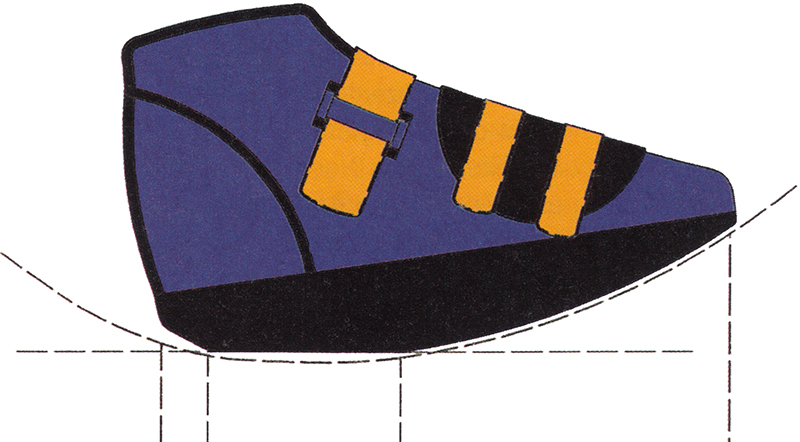Dem Schmerz auf der Spur
Meist ist es der Schmerz, der die Patienten zum Arzt und zum Orthopädieschuhmacher führt. Wie gut die Therapie gelingt, hängt in hohem Maß davon ab, wie genau man die eigentliche Schmerzursache erkennt. Erst daraus ergibt sich die Auswahl und die individuelle Ausarbeitung des Hilfsmittels. An diesem Punkt setzt der Partnerverbund Ietec mit seinem Biopathotec-Konzept an.
Von Wolfgang Best

Der auf den ersten Blick etwas sperrig wirkende Begriff „Biopathotec“setzt sich aus den Begriffen „Biologie“, „Pathomechanismus“ und „Technologie“ zusammen. Dahinter verbirgt sich der Anspruch, alle Bereiche in der Versorgung zusammenzuführen. „Ich muss zum einen wissen, woher der Schmerz kommt, und zum anderen, warum ich eine bestimmte Versorgungstechnik wähle“, erläutert Ietec-Gründer Jürgen Stumpf den Anspruch des Konzeptes. Vor einer Versorgung wird also nicht nur Maß genommen, sondern am Anfang steht immer eine ausführliche Anamnese, Befundung und Analyse.
Dabei wird zunächst der Patient ausführlich zu seinen Schmerzsymptomen befragt. Danach folgt eine funktionelle Untersuchung, um die Beschwerden einstufen zu können. „Dazu stehen uns eine ganze Reihe von Tests zur Verfügung“, sagt Sportwissenschaftler Marcel Hardung, der bei Ietec Projektleiter für das Konzept ist. Grundlage ist immer ein Basistest zur Fußfunktion, der je nach den Beschwerden um indikationsbezogene Tests erweitert werden kann, wie zum Beispiel aktive und passive Funktionstests, Muskelfunktionstests oder Tests am Knie oder an der Hüfte. Diese Tests werden durch eine 2-D Videoanalyse und eine Druckverteilungsmessung ergänzt.