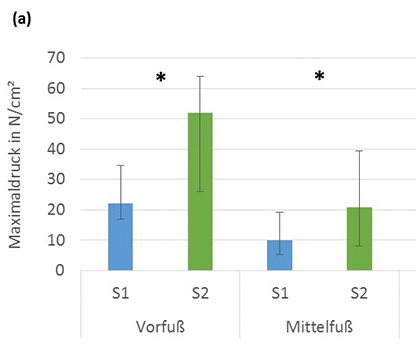Welche Menschen erhalten eine podologische Therapie?
Zusammenfassung
Mitglieder des Deutschen Verbandes für Podologie (ZFD) e. V. erhielten 2015 einen Fragebogen, mit der Bitte, diesen mit den nächsten zehn aufeinander folgenden Patienten auszufüllen. Innerhalb von sechs Wochen gingen 1663 anonymisierte ausgefüllte Fragebögen zurück (926 Männer, mittleres Alter ± SD: 68 ± 11 Jahre; 737 Frauen, 71 ± 12 Jahre).
Ergebnisse: Bei den Männern konnten 62,4 Prozent und bei den Frauen nur 57 Prozent ihre Füße mit ihren eigenen Händen erreichen. Bei den Patienten mit einem Body-Mass-Index (BMI) >35 waren es nur 39,9 Prozent der Männer und 43,9 Prozent der Frauen und im Falle eines HBA1c >9 waren es 50,9 Prozent und 39,3 Prozent.