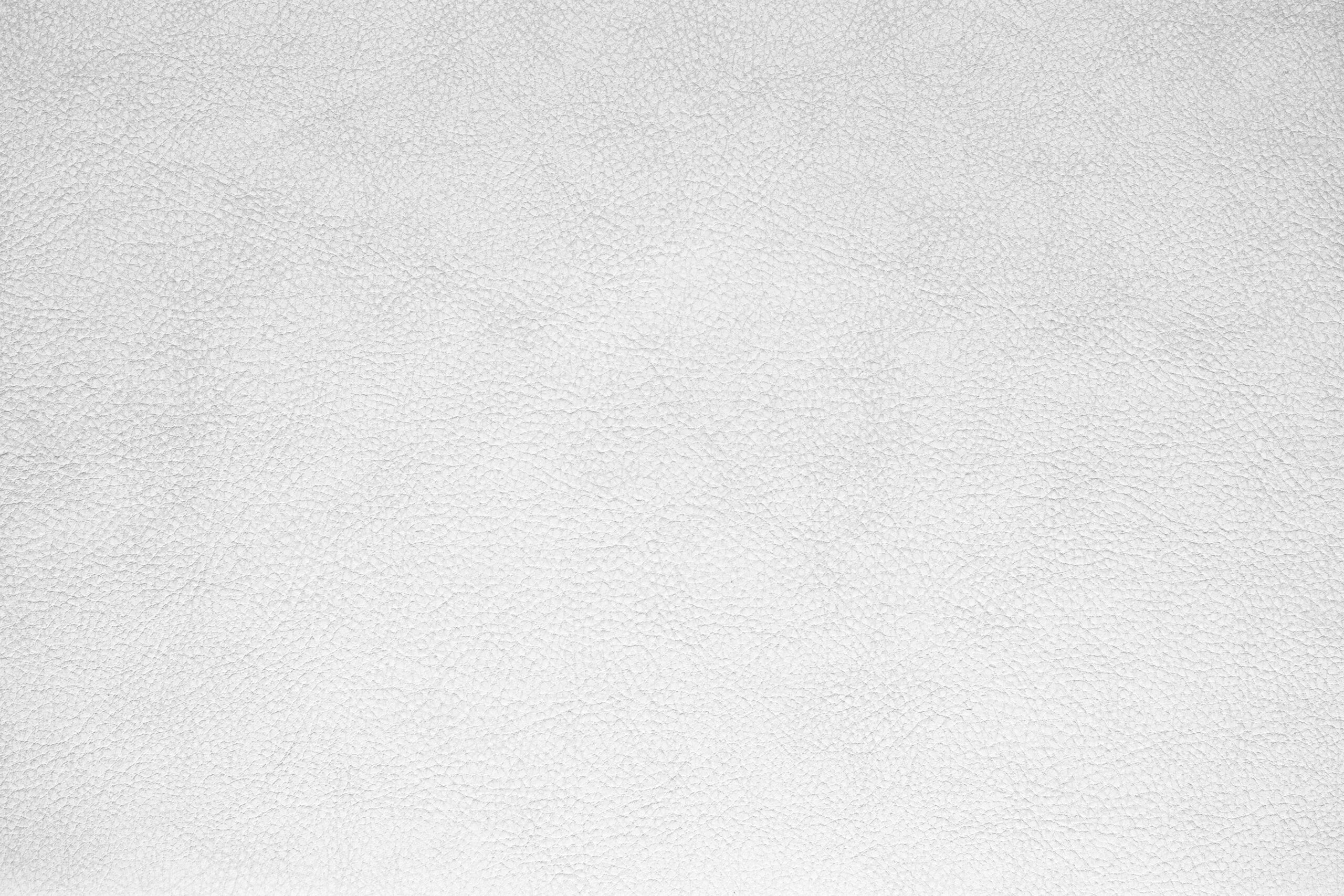Stigmatisierte Krankheiten werden seltener hochgeladen

Die Studie zeigte: Erkrankungen, die gesellschaftlich stark stigmatisiert sind wie Depression oder Geschlechtskrankheiten, können dazu führen, dass Patienten solche Diagnosen eher nicht in ihre ePA hochladen und damit ihren behandelnden Ärzten diese Informationen vorenthalten. Nicht-stigmatisierte Erkrankungen wie ein gebrochenes Handgelenk oder Diabetes Typ 1 haben keinen signifikanten Effekt auf das Hochladeverhalten. Da spielt es auch keine Rolle, ob die Erkrankung akut ist (gebrochenes Handgelenk, Gonorrhoe) oder chronisch (Diabetes Typ 1, Depression).
„Hintergrund unserer Online-Studie war eine im vergangenen Jahr veröffentlichte Umfrage, in der drei von vier Deutschen angaben, dass sie bereit wären, die ePA zu nutzen, und in der öffentlichen Diskussion zuweilen suggeriert wurde, dass dieses Ergebnis gleichbedeutend sei mit einer hohen Nutzungsbereitschaft“, sagt Niklas von Kalckreuth. „Wir wissen aber aus anderen und unseren eigenen Studien am Fachgebiet, dass die Absichtsbekundung allein keine zuverlässige Aussage über die tatsächliche Nutzung einer Technologie ist. Es besteht oft eine Lücke zwischen erklärter Absicht und tatsächlichem Verhalten.“ Mit der Studie wollten die Wissenschaftler herausfinden, ob eine solche Lücke auch bei der Nutzung der ePA besteht und wenn ja, welche Faktoren diese Lücke erklären können.
Interaktion mit einem Click-Dummy
In einem ersten Schritt machten sich die 241 Studien-Teilnehmenden mit der ePA bekannt. Ihnen wurde ein sogenannter Click-Dummy der ePA vorgelegt, mit dem sie interagieren konnten. Im zweiten Schritt bekamen sie einen von vier medizinischen Befunden vorgelegt, die sowohl nach ihrem Stigmatisierungspotenzial als auch nach ihrem zeitlichen Verlauf, also ob die darin beschriebene Erkrankung akut oder chronisch ist, variierten.
„Ein gebrochenes Handgelenk stand für eine akute Erkrankung mit niedrigem Stigma. Für die chronische Erkrankung mit niedrigem Stigma wählten wir Diabetes Typ 1. Niedriges Stigma heißt, die Patienten befürchten keine negativen, ausgrenzenden beruflichen und/oder sozialen Folgen. Hohes Stigma bedeutet, dass zum Beispiel Menschen mit einer Depression Angst haben, durch die Krankheit ‚gebrandmarkt‘ zu werden und deswegen eventuell berufliche Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Für die akute Erkrankung mit hohem Stigma entschieden wir uns für die Geschlechtskrankheit Gonorrhoe und für die chronische Erkrankung mit hohem Stigma für die Depression“, erläutert Niklas von Kalckreuth.
Als nächstes wurden die Teilnehmenden gebeten zu entscheiden, ob sie die Diagnose, die ihnen gezeigt wurde, in ihre ePA hochladen würden. Die Teilnehmenden waren alle gesund und hatten zum Zeitpunkt der Befragung keinen Bezug zu den vier Krankheiten.
Ergebnisse
Von den 74 Teilnehmenden, die den Befund Gonorrhoe erhielten, luden 50 ihre Diagnose hoch. Von den 56 mit dem Befund Depression waren es 31. Bei den 62 Teilnehmenden mit der Diagnose Handgelenksfraktur waren es 53 und bei den 49 Teilnehmenden mit der Diagnose Diabetes Typ 1 speicherten 46 den Befund in der ePA. Das heißt, dass das Hochladen der Diagnosen mit hohem Stigma, also Gonorrhoe und Depression, sechsmal häufiger abgelehnt wurde als das Hochladen der Diagnosen mit niedrigem Stigma (gebrochenes Handgelenk und Diabetes Typ 1). „Ob eine Krankheit akut ist oder chronisch, beeinflusst laut unserer Studie die Entscheidung, die Diagnose in der ePA zu speichern, nicht“, so von Kalckreuth.
Verhalten hängt nicht nur von Akzeptanz ab
Des Weiteren untermauert die Studie der beiden Wissenschaftler, dass sich von der Nutzungsakzeptanz nicht eins zu eins auf das konkrete Verhalten schließen lässt. Niklas von Kalckreuth: „Nachdem die Teilnehmenden sich mit der ePA vertraut gemacht hatten, mussten sie ihre Nutzungsakzeptanz angeben. Jene, die die ePA grundsätzlich befürworten, luden ihren Befund zweimal so häufig hoch, als jene, bei denen die Akzeptanz niedrig war. Darüber hinaus zeigte sich, dass Krankheiten mit hohem Stigmatisierungspotential in der ePA weniger häufig gespeichert wurden, auch bei denen, deren Akzeptanz gegenüber der ePA grundsätzlich hoch war.“
Notwendig: transparente Aufklärung über Sicherheitsstandards
Aus den Ergebnissen ihrer Online-Studie schließen Niklas von Kalckreuth und Prof. Dr. Markus Feufel, dass sich Menschen beim Hochladen sensibler Gesundheitsdaten um deren Sicherheit Sorgen machen und dies im Zweifelsfall verweigern.
„Soll die ePA die Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems vorantreiben und ihr Potenzial entfalten – zum Beispiel um die Verfügbarkeit von medizinischen Daten zu verbessern und Doppelbehandlungen zu vermeiden – wäre es wichtig, die Zeit bis zu ihrer Einführung für alle gesetzlich Versicherten am 1. Januar 2025 zu nutzen, transparent und verständlich über die hohen Sicherheitsstandards der ePA aufzuklären. Ziel muss es sein, etwaige Sorgen bezüglich der Datensicherheit auszuräumen und zwar auch für Bevölkerungsgruppen, die der ePA gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt sind“, sagt Niklas von Kalckreuth.
.