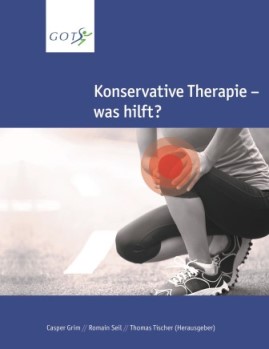Konservative Therapie beim kindlichen (Knick-)Senkfuß

Die Sorge um den auffälligen Kinderfuß gehört zu den häufigsten Gründen, weshalb Eltern mit ihren Kindern in die Arztsprechstunde kommen. Der kindliche (Knick-)Senkfuß ist normaler-weise ein physiologischer Zustand im Kleinkindesalter, welcher sich in der Regel spontan korrigiert (Speth & Hellmich 2017). Problematisch bleibt die frühzeitige Identifikation von (Knick-) Senkfüßen, die sich nicht physiologisch zu einem „Normalfuß“, sondern zu einer schmerzhaften Fußdeformität entwickeln (Larsen 2008). Diese weisen im Laufe der Zeit oft eine funktionelle Beeinträchtigung auf (Hefti & Brunner 1999) und können zu einer Schmerz-symptomatik führen (Menz et al. 2013a, b; Gross et al. 2013).
Mit einem Abonnement erhalten Sie Zugriff auf alle Online-Inhalte. Mit einem Premium-Abonnement erhalten Sie zusätzlich viele Angebote rund um die Orthopädieschuhtechnik umsonst oder stark vergünstigt.
Nutzen Sie Ihr Abonnement auch digital und profitieren Sie von der großen Fachartikelvielfalt . Der Zugang ist bei Ihrem Abonnement bereits enthalten und für Sie kostenlos.