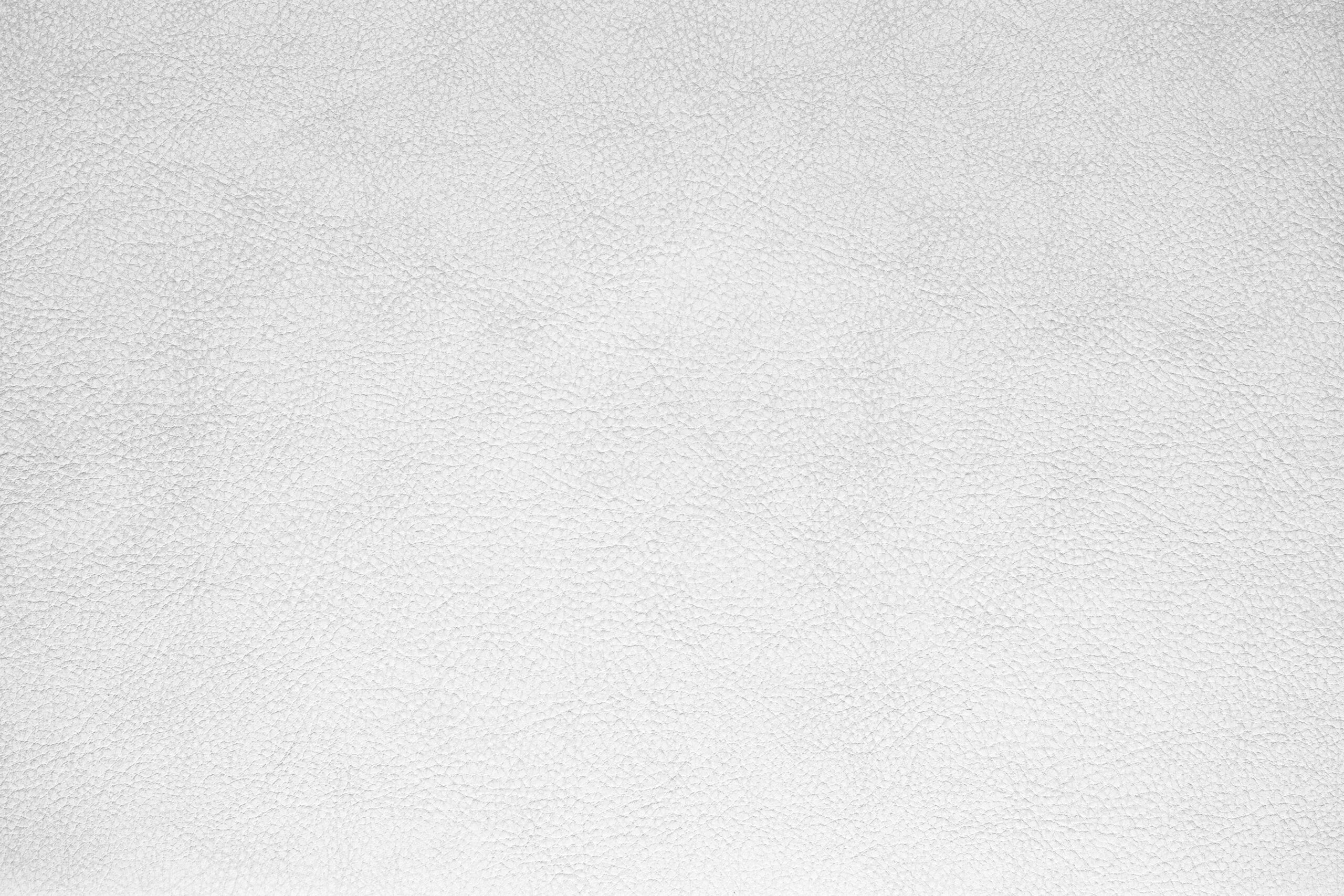Veränderungen für Leistungserbringer

Rechtsanwalt Dr. Dirk Usadel prüft angesichts von Rechtsstreitigkeiten derzeit, ob ein Meister auch mehrere Filialen abdecken darf. In seinem Vortrag spielte er dies am Modell eines orthopädietechnischen Sanitätshauses durch, das in vier seiner Filialen zusätzlich Produkte der Orthopädieschuhtechnik abgeben möchte. Diese werden in einer vom Sanitätshaus betriebenen Zentralwerkstatt gefertigt; das Sanitätshaus möchte dieses Konzept mit einem einzigen Orthopädieschuhmacher-Meister leben. Dieser ist vormittags in der Zentralwerkstatt anwesend und nachmittags jeweils zwei Stunden pro Woche in einer der vier Filialen. Die Anwesenheitszeiten des Meisters sind für die Kunden jeweils deutlich erkennbar.
Dr. Usadel zeigte sich überzeugt, dass der Meister seine Zeit zwischen der Zentralwerkstatt und den vier Filialen aufteilen darf. Nach der Handwerksordnung sei der Meister frei darin, wann er handwerkliche Aufträge entgegennehme, die entsprechenden Arbeiten ausführe und bestellte Güter abgebe.
Der Handwerksordnung zufolge dürfe man auch sogenannte unselbstständige Betriebsstätten einrichten, so Usadel. Deren Unselbstständigkeit sei dadurch definiert, dass diese Betriebsstätten in jeder Beziehung von der Hauptniederlassung des Unternehmens abhängig sind. Man könne sich das so vorstellen, dass bei unselbstständigen Niederlassungen ein einheitlicher Geschäftsbetrieb an lediglich räumlich verschiedenen Stellen vorliege. Ein Eintrag in die Handwerksrolle sei daher nicht erforderlich. Eine bestimmte Arbeitszeit für meisterliche Arbeiten dürfe dort nicht überschritten werden. Die Unerheblichkeitsgrenze sei in der Handwerksordnung definiert.
Das Recht zur Begründung von Zweigniederlassungen finde seine Grenzen jedoch im Befähigungsgrundsatz, der die Leitung eines Handwerksbetriebs durch einen befähigten Handwerker fordert (sogenannte Präsenzpflicht). Handele es sich aber, wie im vorliegenden Beispiel, um eine nichtselbstständige Betriebsstätte, die vom Hauptbetrieb aus geleitet wird, bestehe dort eine solche Präsenzpflicht nicht. Dieser Aspekt spiele im Beispielsfall jedoch keine Rolle, weil zu den Zeiten, in denen handwerkliche Leistungen erbracht werden, stets der Meister anwesend sei.
Man habe die rechtlichen Gestaltungen der gesetzlichen Krankenkassen im Kopf, wenn man meine, jeder Arbeitsschritt, zum Beispiel der Einlagenfertigung, müsse vom Meister persönlich erbracht werden – und wenn man glaube, dass die meisterliche Überwachung der unselbstständigen Betriebsstätte nicht auch von der Hauptniederlassung aus vorgenommen werden könne, so Usadel. Er betonte, dass insoweit für Krankenkassen das Handwerksrecht vorrangig sei. Wenn eine Handwerkskammer einen Betrieb als Meisterbetrieb eintrage und seine unselbstständige Zweigstelle als solche akzeptiere, sei die Krankenkasse daran gebunden. Wie das Bundessozialgericht entschieden habe, folge das Sozialversicherungsrecht insoweit grundsätzlich dem Meisterrecht, nicht umgekehrt.
Usadel wies darauf hin, dass Vertragsklauseln, die über das Handwerksrecht hinausgehen, weil sie eine durchgehende Meisterpräsenz undifferenziert bei jedem handwerklichen Versorgungsschritt vorschreiben, in Beitrittsverträgen nichtig sein dürften. Hier gelte das AGB-Recht. Der ursprüngliche Vertrag zwischen Kasse und Innung möge zwar rechtens sein, doch der beitretende Betrieb sei nicht an AGB-rechtswidrige Klauseln gebunden, da er nicht individuell verhandeln konnte. Sofern Empfehlungen des GKV-Spitzenverbands vom Handwerksrecht abweichende Regelungen vorsähen, gelte prinzipiell das Gleiche: Die Empfehlungen seien sogenanntes Verwaltungsbinnenrecht und damit im Streit zwischen Krankenkasse und Leistungserbringer durch ein Gericht überprüfbar.
In der Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass die einzelnen Handwerkskammern bei der Meisterpräsenz und der Handhabung der unselbstständigen Zweigstellen durchaus unterschiedliche Positionen vertreten. Deshalb müssten bis auf Weiteres in den verschiedenen Bundesländern individuelle Lösungen mit den Handwerkskammern gefunden werden.
BGH-Urteil zum Zuzahlungsverzicht wird Folgen haben
Dr. Dirk Usadel ging am Rande auch auf das aktuelle Urteil des Bundesgerichtshofs ein, das die Werbung eines Hilfsmittel-Leistungserbringers mit dem Erlassen der gesetzlichen Zuzahlung als rechtens erklärte. „Dieses Urteil zeigt eine aktuelle Entwicklung auf!“, warnte er. „Die Krankenkassen und die Politik reiben sich die Hände, aber die Betriebe haben das Nachsehen.“ Er sehe es kommen, dass die Preise durch Unterbieten abwärts rauschen und die Leistungserbringer nicht darauf vorbereitet sind.
„Spätestens jetzt muss ein Ruck durch die Branche gehen! Die Innungen müssen – jetzt! – ihre Mitglieder beraten, wie sie ihre Ausrichtung überdenken können, und ihnen Gestaltungen aufzeigen, sich beispielsweise zu spezialisieren, gegebenenfalls auch hilfsmittelferne Leistungen in ihr Angebotsspektrum aufzunehmen, möglicherweise auch zu fusionieren oder auch aufzugeben.“
Unabhängig davon müssten die Kassenverträge genauer gelesen werden (nicht nur die Preislisten) und die Betriebe von den Kassen gegebenenfalls Verhandlungen über Punkte verlangen, die sie nicht oder nicht so erfüllen wollen, zum Beispiel weil sie Standardisierungs- oder Digitalisierungsprozesse betrieblich umsetzen möchten. Das gelte für jeden Beitrittsvertrag, hätte jedoch über die Zeit auch positive Auswirkung auf die Vertragsinhalte.
Die Leistungserbringer dürften sich nicht mehr auf Rezepte als vorrangige Ertragsquelle stützen, sondern müssten sie als Mittel ansehen, um Patienten in ihre Geschäfte zu bekommen und ihnen dann auch Produkte verkaufen zu können, die jenseits der Kostenerstattung durch die Krankenkassen liegen. Diese Entwicklung sei bei manchen Betrieben schon erkennbar. Er beobachte bei der AOK Bayern den Einwand bei Kostenvoranschlägen, dass es preisgünstiger sei, wenn zum Beispiel der Orthopädieschuhmacher nur noch Maß nimmt, die Maßschuhe dann aber extern hergestellt werden und der Meister vor Ort dann wieder anpasst. „Weiter wie bisher geht nicht mehr, Sie müssen etwas tun und die Betriebe auf diese Entwicklung einstellen!“, sagte Usadel speziell zu den anwesenden Innungsvertretern.
Das Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz in der Diskussion
Jürgen Baden, Leiter Gesundheitswesen bei Bauerfeind, beleuchtete den Referentenentwurf für das Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG) aus Sicht der Hersteller. Kritisch bewertete er, dass die Leistungserbringer den Krankenkassen die Aufzahlungen der Patienten transparent machen sollen. Angesichts dessen, dass die AOKen über die Hälfte des Marktanteils in Betrieben haben können, könnten sie von den Aufzahlungen leicht auf die wirtschaftliche Situation der Leistungserbringer rückschließen. Auch bewertete Baden die Offenlegung von Aufzahlungen als geeignet, um höherwertige Versorgungen einzuschränken, was nicht im Sinne einer qualitätsorientierten Versorgung sein könne.
Bedenken äußerte Baden vor allem hinsichtlich der geplanten Regelungen zum Hilfsmittelverzeichnis. Dabei unterstrich er zunächst, wie einflussreich die Listung eines Produkts im Hilfsmittelverzeichnis ist. Sie bestimme maßgeblich den Marktzugang und das Überleben von Produkten auf dem Hilfsmittelmarkt. Baden kritisierte, dass Hersteller laut Referentenentwurf künftig Wirkungsnachweise für sämtliche Indikationen, für die ein Hilfsmittel eingesetzt werden kann, vorlegen müssen. Das sei angesichts der Schwierigkeit, genügend Patienten für entsprechende Studien zu bekommen und diese mit Kliniken durchführen zu können, nicht zu leisten – erst recht nicht in dem geforderten „angemessenen Zeitraum“, der im Ermessen des GVK-Spitzenverbands liege.
Angesichts dessen, dass der GKV Spitzenverband künftig die Nachweise auch von bereits gelisteten Hilfsmitteln überprüfen soll, befürchtet Baden eine Reihe von Auslistungen aus dem Hilfsmittelverzeichnis. Auch hier sei die „angemessene Frist“ zur Nachreichung von Nachweisen sicher nicht ausreichend. Die Auslistungen könnten spürbare Auswirkungen auf die Versorgungslage haben.
Baden forderte, dass die Verfahrensordnung, die der GKV-Spitzenverband formulieren soll, eng von Herstellern und Leistungserbringer-Verbänden begleitet werden muss. Auch müsse vom Gesetzgeber sichergestellt werden, dass sie Richtliniencharakter bekomme und die Hersteller rechtlich schütze.
„Mir wäre am liebsten, das HHVG käme nicht; es hat für Leistungserbringer nur Nachteile“, konstatierte Dr. Axel Friehoff, Leitung Vertragsmanagement und Verbände bei der EGROH. Bei Ausschreibungen werde nichts besser. Die Vorgabe, mehrere aufzahlungsfreie Produkte anzubieten, und das anvisierte Mehr-Partner-Modell führten nur dazu, dass der Versicherte wählen könne, bei wem er aufzahlen wolle, sofern ihm an der Qualität der Versorgung liege.
Dadurch, dass sich die Präqualifizierungsstellen bei der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) zertifizieren müssen, werde die Präqualifizierung für die Leistungserbringer erheblich teurer. Die DAkkS spreche sich derzeit dafür aus, dass sich sowohl die Präqualifizierungsstellen als auch die Leistungserbringer jährlich überwachen lassen müssen. Friehoff vertrat die Auffassung, dass dadurch nichts besser werde. Mit Zertifizierungen könne man ohnehin nur Abläufe verbessern, nicht aber die Ergebnisse.
Darüber hinaus bringe das HHVG für die Leistungserbringer einen erheblichen Mehraufwand, da sie erstens die Beratung, zweitens die Aufzahlungen sowie drittens die gesundheitliche Entwicklung des Patienten während der Therapie dokumentieren müssten. „Dafür bekommen wir kein Geld – und wir wissen noch nicht einmal, was hinterher mit diesen Daten gemacht wird“, kritisierte Friehoff. Wiederholt wies er darauf hin, dass ein Anhörungsrecht für die Leistungserbringer-Verbände nicht ausreichend sei. Immer wieder sei zu erleben, dass der GKV-Spitzenverband die Eingaben der Verbände nicht berücksichtige.
Artikel aus Orthopädieschuhtechnik 01/ 2017