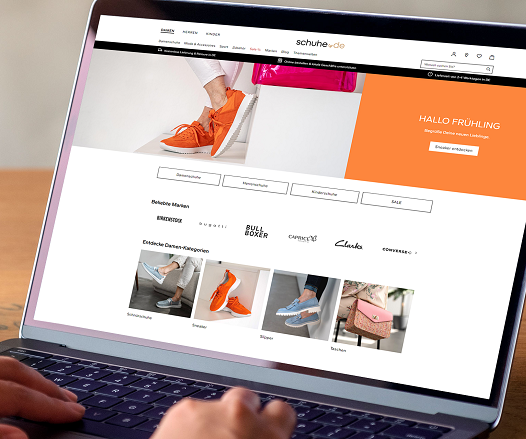Die Behandlung von Apoplex-Patienten mit der dynamischen Unterschenkelorthese in Prepreg-Technik nach Hafkemeyer
Seit mehr als 30 Jahren beschäftige ich mich sowohl physiotherapeutisch als auch medizinisch mit der Behandlung von cerebralparetischen Kindern und Jugendlichen, zu denen auch ein Großteil halbseitengelähmter Kinder zählen, die häufig bereits intrauterin einen Apoplex erlitten haben, der nach der Geburt durch die motorischen Seitendifferenzen auffällig wird. Diese Patienten sind orthopädietechnisch in aller Regel gut versorgbar und mit geeigneten Hilfsmitteln in der Lage, im Alltag mit ihrer Orthese ein hohes Maß an Selbstständigkeit zu erlangen.
Kompetenz in Technischer Orthopädie vermitteln
Mit einem Abonnement erhalten Sie Zugriff auf alle Online-Inhalte. Mit einem Premium-Abonnement erhalten Sie zusätzlich viele Angebote rund um die Orthopädieschuhtechnik umsonst oder stark vergünstigt.
Nutzen Sie Ihr Abonnement auch digital und profitieren Sie von der großen Fachartikelvielfalt . Der Zugang ist bei Ihrem Abonnement bereits enthalten und für Sie kostenlos.