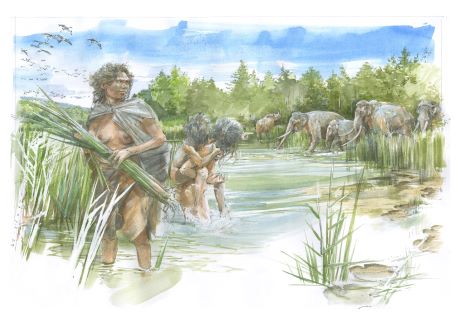Altersunterschiede beim Gehen unter Einfach- und Mehrfachtätigkeit
Altersunterschiede beim Gehen unter Einfach- und Mehrfachtätigkeit VON GRANACHER U1,2, MÜHLBAUER T1, BRIDENBAUGH S3, WEHRLE A3, KRESSIG RW3
Zusammenfassung
Das Alter ist geprägt durch kognitive und somatosensorische Funktionseinbußen, die zu Veränderungen im Gangbild führen. Daher war es das Ziel der Studie, die Auswirkungen kognitiver und motorischer Zusatzaufgaben auf die Gehgeschwindigkeit
junger und älterer Menschen zu untersuchen.
An der Studie nahmen 36 gesunde junge (n = 18, Alter 22,3 ± 3,0 Jahre, BMI 21,0 ± 1,6 kg/m²) und ältere Probanden (Pbn) (n = 18, Alter 73,5 ± 5,5 Jahre, BMI 24,2 ± 1,6 kg/m²) teil. Zur Bestimmung der kognitiven Leistung wurden der „Mini-Mental-State“ und der „Clock- Drawing-Test“ herangezogen. Die Gehgeschwindigkeit wurde mit Hilfe eines drucksensitiven Gangteppichs (GAITRite System®) unter Einfach- (Gehen), Doppel- (Gehen + kognitive Interferenz [KI] oder motorische Interferenz [MI]) und Dreifachtätigkeitsbedingung (Gehen + KI + MI) erfasst. Unabhängig von der Testbedingung gingen die älteren gegenüber den jüngeren Pbn langsamer (p < .001, in allen Bedingungen). Mit zunehmender Aufgabenkomplexität reduzierte sich die Gehgeschwindigkeit in beiden Altersgruppen (p ≤ .002, in beiden Gruppen). Die größere Reduktion der Gehgeschwindigkeit unter Mehrfachbedingungen älterer im Vergleich zu jüngeren Pbn deutet darauf hin, dass die Regulation des Ganges im Alter weniger automatisiert ist, das heißt mehr Aufmerksamkeitsressourcen benötigt. Aufgrund der alltagsnahen Bedeutsamkeit von Mehrfachtätigkeiten während des Gehens, wird zur Überprüfung der funktionellen Mobilität, die Ermittlung der Gehgeschwindigkeit unter Einbezug von Zusatzaufgaben empfohlen.